Verhalten
-

Soziale Gene: Was Bienen und Menschen verbindet
Eine neue Studie zeigt, dass Honigbienen und Menschen gemeinsame genetische Grundlagen für soziales Verhalten haben. Forscherinnen fanden bei Bienen Varianten, die auch beim Menschen mit Interaktion verbunden sind. Das deutet auf evolutionär alte Bausteine der Geselligkeit hin, die über 600 Millionen Jahre hinweg bestehen.
-

Schnelles Gehirnwachstum könnte Grund für den „Babytalk“ sein
Menschen und Marmosets lernen Sprache ähnlich – durch frühes Babbeln und elterliches Feedback. Grund ist das besonders schnelle Gehirnwachstum in den ersten Lebensmonaten. Die Ergebnisse erklären, warum Feedback-basiertes Sprachlernen evolutionär selten ist, aber beim Menschen zentral.
-

Orang-Utans lernen Nestbau durch Zuschauen und jahrelanges Üben
Eine Langzeitstudie zeigt: Junge Orang-Utans lernen den komplexen Nestbau durch genaues Beobachten und jahrelanges Üben. Dabei übernehmen sie Techniken von ihren Müttern und später auch von anderen. Nestbau erweist sich als kulturelles Verhalten – und als Schlüssel zum Überleben im Regenwald.
-
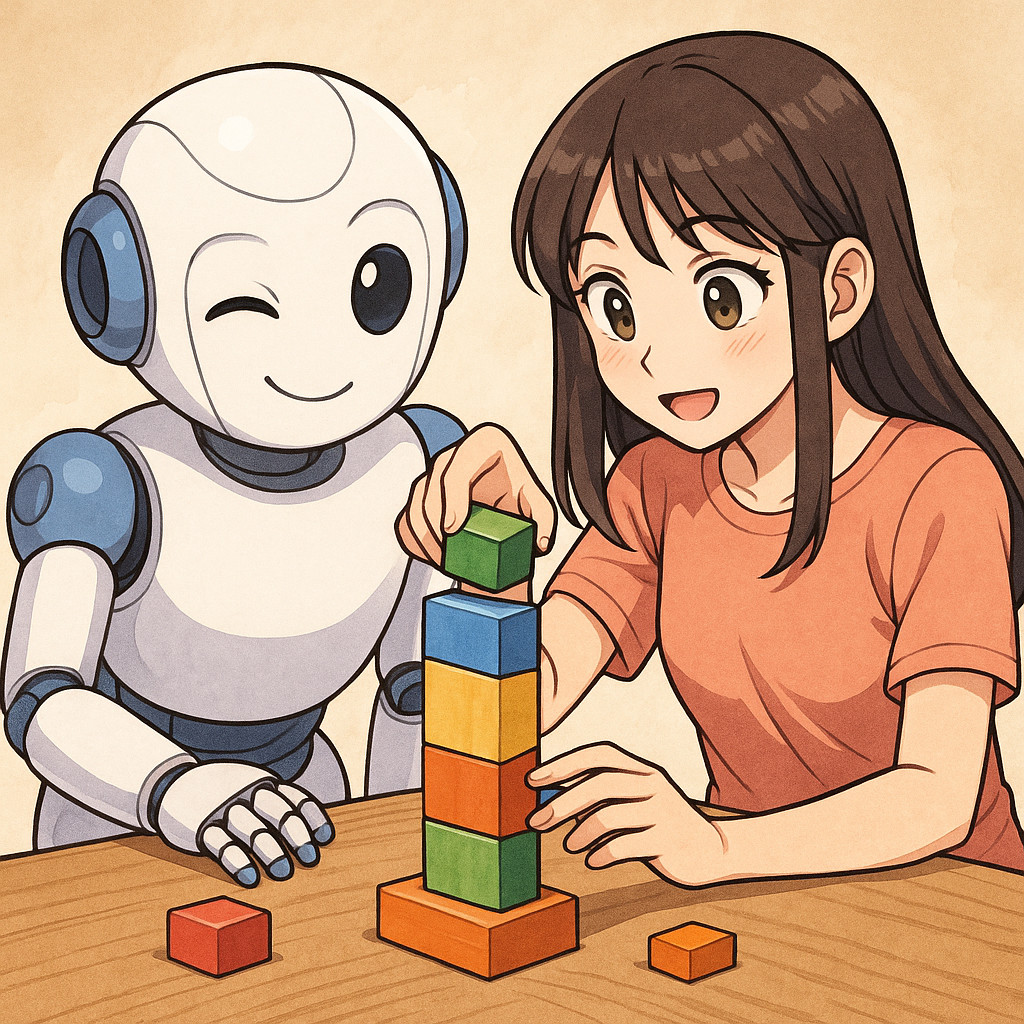
Auge in Auge: Wie Blickverläufe unser Miteinander prägen
Eine neue Studie zeigt: Nicht nur ob, sondern wann wir Blickkontakt herstellen, entscheidet über Kommunikationserfolg – sogar mit Robotern. Der richtige Ablauf von Blickbewegungen beeinflusst, ob Hilfsbedürftigkeit erkannt wird. Das eröffnet neue Möglichkeiten für soziale Robotik, Trainings und Inklusion.
-

Dominanz bei Primaten ist komplexer als gedacht
Eine groß angelegte Studie widerlegt das Klischee vom allgegenwärtigen Alphamännchen in der Tierwelt. Bei den meisten Primatenarten sind Machtverhältnisse zwischen Männchen und Weibchen überraschend ausgeglichen. Das stellt auch populäre Vorstellungen über natürliche Geschlechterrollen beim Menschen auf den Prüfstand.
-

Soziales Netzwerk entscheidend für Überlebens-Chancen von Schimpansen-Babys
Eine Langzeitstudie zeigt: Schimpansenbabys haben deutlich höhere Überlebenschancen, wenn ihre Mütter vor der Geburt gut sozial integriert sind. Entscheidend sind weibliche Kontakte – nicht Verwandte oder Männchen. Die Ergebnisse liefern auch neue Einblicke in die evolutionären Wurzeln menschlicher Kooperation.
-

Hirn in Geberlaune: Wie unsere Amygdala Großzügigkeit steuert
Forschende aus Düsseldorf und internationalen Partnerländern haben gezeigt: Die basolaterale Amygdala im Hirn reguliert, wie großzügig wir gegenüber anderen Menschen sind – abhängig von der emotionalen Nähe. Besonders deutlich wird das bei Patienten mit einer seltenen Hirnschädigung. Ihre Entscheidungen offenbaren ein biologisches Kalibriersystem für Mitgefühl.

