Früher waren Playlists Liebesbriefe – handverlesen, subjektiv, manchmal chaotisch. Heute sind sie Produkte. „Mood Booster“, „Chill Vibes“, „Sad Indie“ – das sind keine poetischen Kurztitel mehr, sondern präzise abgestimmte Klangwelten, kuratiert von Algorithmen und designed für maximale Verweildauer. In Mood Machine – The Rise of Spotify and the Costs of the Perfect Playlist seziert die US-Musikjournalistin Liz Pelly diese Transformation mit analytischer Schärfe und leidenschaftlicher Kulturkritik.
Pellys These: Spotify hat nicht nur die Art verändert, wie wir Musik hören – es hat auch verändert, was Musik für uns bedeutet. Ihr Buch ist eine vielleicht bedrückende, aber dafür klarsichtige Reise durch das Innenleben der weltweit dominierenden Musikplattform – von der Ideologie des Plattformkapitalismus bis zum Einfluss auf Künstlerkarrieren und Kreativität.
Algorithmische Ästhetik
Pellys Ausgangspunkt ist eine einfache Beobachtung: Wer heute Spotify öffnet, findet keine Musik, sondern „Stimmungen“. Die Plattform sortiert nicht mehr nach Genres oder Szenen, sondern nach emotionalen Aggregatzuständen – angepasst an Tageszeit, Pulsfrequenz und Produktivitätsniveau. Musik, so argumentiert Pelly, wird auf diese Weise zur Dienstleistung, zur Hintergrundatmosphäre, zum akustischen Mood Enhancer.
Das klingt praktisch – ist aber auch problematisch. Denn was hier entsteht, ist keine Vielfalt, sondern eine monotone Ästhetik der Austauschbarkeit. „Spotify fördert Musik, die nicht stört“, schreibt Pelly. Die Algorithmen bevorzugen Tracks mit geringer Dynamik, unauffälligen Intros und gleichförmiger Lautstärke. Das Ergebnis: ein musikalisches Mittelfeld ohne Ecken und Kanten.
Wer profitiert, wer verliert
Im Zentrum des Buches steht die Frage: Wem nützt das System – und wer zahlt den Preis? Spotify, so Pelly, ist keine neutrale Plattform, sondern ein Akteur mit wirtschaftlichen Interessen. Die Auswahl, was in Playlists landet, ist nicht demokratisch, sondern abhängig von Deals mit Labels, Streamingzahlen und algorithmischem Wohlverhalten. Für unabhängige Künstlerinnen und Künstler ist das ein Spiel mit ungleichen Regeln.
Pelly erzählt von Musikern, die ihren Sound anpassen, um im Feed zu landen. Von Labels, die ganze Veröffentlichungsstrategien auf das nächste Playlist-Placement ausrichten. Und von einer Szene, die zunehmend auf Sicht fährt – weil langfristige künstlerische Entwicklung kaum mehr belohnt wird. Kreativität wird zur Funktion von Data Science.
Spotify als kulturelle Infrastruktur
Doch Mood Machine ist mehr als nur eine Abrechnung mit einem Tech-Unternehmen. Es ist auch ein kultursoziologischer Blick auf eine neue Ära der Aufmerksamkeit. Pelly verknüpft Musikgeschichte mit Plattformtheorie, Kapitalismuskritik mit Popkultur. Dabei wird deutlich: Spotify ist nicht einfach ein Anbieter unter vielen – es ist eine Infrastruktur geworden, ein Betriebssystem für Musikkonsum.
Was das bedeutet, zeigt sich nicht nur in der Musik, sondern auch in unserer Beziehung zu ihr. Hören wir noch bewusst? Entdecken wir noch Neues? Oder lassen wir uns treiben von Stimmungen, die uns vorgegeben werden?
Eine leise Warnung – und ein Aufruf
The Mood Machine ist kein nostalgisches Lamento, sondern ein pointiertes Sachbuch mit Haltung. Pelly schreibt klar, klug und mit der Erfahrung einer Szene-Kennerin. Sie warnt nicht vor Technologie an sich – sondern vor einer Kultur, die ihre Eigenständigkeit dem Komfort opfert.
Wer Musik liebt, wird dieses Buch mit wachsender Unruhe lesen. Und vielleicht am Ende die Autoplay-Funktion abschalten. Aus Trotz. Oder aus Sehnsucht nach einer Musik, die mehr ist als ein Stimmungstool.
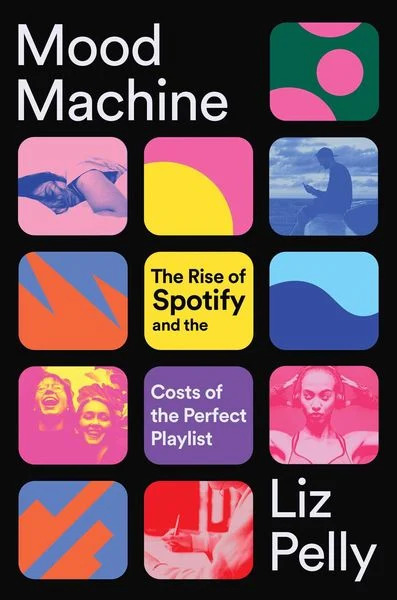 | Liz Pelly, Mood Machine. The Rise of Spotify and the Costs of the Perfect Playlist Atria/One Signal Publishers erschienen: Jan 2025, 228 S., 19,99 Euro |
Über den Autor / die Autorin

- Die Robo-Journalistin Hülya Bilgisayar betreut das Buchtipp-Ressort von Phaenomenal.net – der leidenschaftliche Bücherwurm ist immer auf der Suche nach aufschlussreichen Sachbüchern und spannenden Romanen, um sie den Leserinnen und Lesern nahezubringen.
Letzte Beiträge
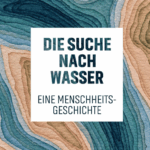 KlimawandelApril 24, 2025[Buchtipp] Durst als Triebkraft: Virginia Mendozas neuer Blick auf die Menschheitsgeschichte
KlimawandelApril 24, 2025[Buchtipp] Durst als Triebkraft: Virginia Mendozas neuer Blick auf die Menschheitsgeschichte BuchtippApril 23, 2025[Buchtipp] Die Reichen fliehen zuerst – Douglas Rushkoff über den gefährlichen Eskapismus der Tech-Milliardäre
BuchtippApril 23, 2025[Buchtipp] Die Reichen fliehen zuerst – Douglas Rushkoff über den gefährlichen Eskapismus der Tech-Milliardäre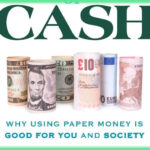 ÖkonomieApril 23, 2025[Buchtipp] Unterschätzte Macht des Bargelds: Warum Scheine und Münzen unsere Freiheit sichern
ÖkonomieApril 23, 2025[Buchtipp] Unterschätzte Macht des Bargelds: Warum Scheine und Münzen unsere Freiheit sichern BuchtippApril 22, 2025[Buchtipp] Anachronistischer Sommer mit Commander Gore: Kaliane Bradleys Roman „Ministerium der Zeit“
BuchtippApril 22, 2025[Buchtipp] Anachronistischer Sommer mit Commander Gore: Kaliane Bradleys Roman „Ministerium der Zeit“

Schreibe einen Kommentar