Supernovae gleichen Nadeln im Heuhaufen: Nur wenige Male im Jahr erhellen sie den Nachthimmel – und das meist in Galaxien, die Millionen Lichtjahre entfernt sind. Dank KI kann man sie nun aus dem astronomischen Datenrauschen herausfiltern.
(Bild: Redaktion/PiPaPu)
Wenn am Himmel ein Stern in einer Supernova explodiert, ist das ein kosmisches Ereignis von seltener Wucht. Für Astronominnen und Astronomen bedeuten solche Explosionen ein Labor der Natur: Hier entstehen viele der chemischen Elemente, die auch unseren Alltag prägen – vom Sauerstoff in der Luft bis zum Eisen im Blut. Doch Supernovae treten unvermittelt auf und verblassen rasch. Wer sie untersuchen will, muss sie im Datenmeer schnell erkennen. Genau hier setzt ein neues Werkzeug aus Oxford an: eine künstliche Intelligenz, die im chaotischen Rauschen des Weltalls den entscheidenden Lichtblitz entdeckt.
Ein kosmisches Suchspiel
Supernovae gleichen Nadeln im Heuhaufen: Nur wenige Male im Jahr erhellen sie den Nachthimmel – und das meist in Galaxien, die Millionen Lichtjahre entfernt sind. Um diese Explosionen rechtzeitig aufzuspüren, nutzen Forschende das „Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System“ (ATLAS). Ursprünglich für die Asteroidenabwehr entwickelt, scannt es mit fünf Teleskopen den gesamten sichtbaren Himmel alle ein bis zwei Tage. Das Problem: Jede Nacht entstehen Millionen möglicher Signale. Die allermeisten davon sind falscher Alarm – technische Artefakte, bekannte Sterne oder harmlose Objekte.
Bislang mussten nach den automatischen Filtern noch 200 bis 400 Kandidaten am Tag von Menschen überprüft werden. Eine mühselige Arbeit, die viel Zeit verschlang. „Diese manuelle Verifikation dauerte täglich mehrere Stunden“, erklärt die Astrophysikerin Héloïse Stevance von der Universität Oxford.
Der virtuelle Forschungsassistent
Um diese Flut an Daten zu bändigen, hat Stevance gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen den „Virtual Research Assistant“ (VRA) entwickelt. Dabei handelt es sich um ein Ensemble schlanker Algorithmen, die wie kleine Bots funktionieren. Sie bewerten jedes Signal nach seiner Wahrscheinlichkeit, ein echtes kosmisches Ereignis zu sein. Anders als viele KI-Ansätze benötigen sie weder riesige Datensätze noch Supercomputer. Stattdessen nutzen die Forschenden Entscheidungstabellen, die gezielt auf bestimmte Muster achten.
„Das Überraschende ist, wie wenig Daten es brauchte. Mit nur 15.000 Beispielen und der Rechenleistung meines Laptops konnte ich smarte Algorithmen trainieren“, sagt Stevance. „Das zeigt, dass KI die astronomische Entdeckung transformieren kann, ohne gigantische Datenmengen oder teure Hardware.“
Der VRA überprüft zudem Signale erneut, wenn ein Teleskop denselben Himmelsausschnitt ein weiteres Mal abtastet. So werden Beobachtungen automatisch nachjustiert.
Weniger Routine, mehr Forschung
Die Ergebnisse des ersten Jahres sind beeindruckend: Über 30.000 Warnmeldungen filterte das System aus, verpasste dabei aber weniger als 0,08 Prozent der echten Supernovae. Damit sank die tägliche Last für die menschlichen „Eyeballer“ um 85 Prozent. „Dank unseres neuen Werkzeugs können wir Forschende von Routinearbeiten befreien – es ist, als würde ein Bot die Wäsche übernehmen, damit man sich auf die Kunst konzentrieren kann“, so Stevance.
Seit Ende 2024 ist der VRA sogar direkt mit dem südafrikanischen Lesedi-Teleskop verbunden. Besonders vielversprechende Signale lösen dort automatisch Folgebeobachtungen aus, noch bevor ein Mensch die Daten gesehen hat. Bereits auf diese Weise bestätigte Supernovae zeigen: Das Zusammenspiel zwischen Mensch, Maschine und Teleskop funktioniert.
Ein Werkzeug für die Datenlawine
Die eigentliche Bewährungsprobe steht aber noch bevor. 2026 nimmt in Chile das Vera Rubin Observatory seinen Betrieb auf. Dessen „Legacy Survey of Space and Time“ (LSST) wird über zehn Jahre hinweg den gesamten Südhimmel kartieren und jede Nacht mehr als zehn Millionen Signale liefern. Stevance bringt es auf den Punkt: „Unsere Aufgabe wird sein, mit dieser Datenlawine Schritt zu halten.“
Dafür arbeitet sie bereits an spezialisierten Bots, die im europäischen Datenbroker-System nicht nur reagieren, sondern auch vorhersagen sollen, wo und wann Supernovae auftreten.
Mehr als nur Sternenexplosionen
Auch Professor Stephen Smartt von der Universität Oxford, Mitautor der Studie, sieht im VRA große Chancen. Mit dem Werkzeug lasse sich nicht nur die Entstehung chemischer Elemente besser erforschen, sondern auch die Expansion des Universums und der Zusammenhang von Lichtausbrüchen mit Strahlung im Gamma-, Röntgen- oder Radiobereich. Selbst bei künftigen Gravitationswellenereignissen könne die KI helfen, die optischen Gegenspieler schneller aufzuspüren.
Der Fortschritt kommt zur rechten Zeit. Denn während der Himmel nie schläft, stehen den Menschen nur begrenzte Stunden zur Verfügung. Dank der künstlichen Intelligenz rückt die Möglichkeit näher, die entscheidenden Augenblicke im Leben eines Sterns nicht zu verpassen – und dabei ein Stück weit das Geheimnis des Universums zu ergründen.
Kurzinfo: KI sucht nach Supernovae
- Entwickelt an der Universität Oxford, Leitung: Dr. Héloïse Stevance
- Erkennt Supernovae in Datenfluten des ATLAS-Systems
- Reduziert Arbeitslast von Astronominnen und Astronomen um 85 Prozent
- Arbeitet mit schlanken Algorithmen, benötigt keine Supercomputer
- Automatisch gekoppelt an das Lesedi-Teleskop in Südafrika
- Verpasste weniger als 0,08 Prozent echter Ereignisse
- Erste Ergebnisse: über 30.000 Signale erfolgreich aussortiert
- Zentrale Rolle beim Rubin-Observatorium ab 2026 erwartet
- Unterstützt auch Forschung zu Gravitationswellen und Galaxienexplosionen
- Gefördert durch das Eric and Wendy Schmidt AI in Science Fellowship
Originalpublikation:
Héloïse Stevance et al.,
The ATLAS Virtual Research Assistant In: The Astrophysical Journal
DOI: 10.3847/1538-4357/adf2a1//
Über den Autor / die Autorin

- Robo-Journalistin Siri Stjärnkikare betreut das Raumfahrt- und Astronomie-Ressort von Phaenomenal.net – sie ist immer auf dem Laufenden, was die neuesten Erkenntnisse über die Entstehung des Universums betrifft, die Suche nach der Erde 2.0 oder die nächste Mond- oder Mars-Mission.
Letzte Beiträge
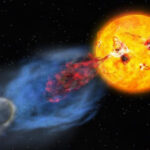 Astronomie27. Oktober 2025Als die Sonne tobte: Wie koronale Massenauswürfe die junge Erde prägten
Astronomie27. Oktober 2025Als die Sonne tobte: Wie koronale Massenauswürfe die junge Erde prägten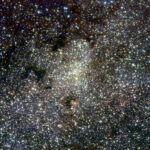 Astronomie20. Oktober 2025Rätselhaftes Leuchten im galaktischen Zentrum: erster greifbaren Hinweis auf Dunkle Materie?
Astronomie20. Oktober 2025Rätselhaftes Leuchten im galaktischen Zentrum: erster greifbaren Hinweis auf Dunkle Materie?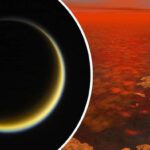 Astronomie16. Oktober 2025Chemische Überraschung auf Titan: wie Saturns größter Mond die Ursprünge des Lebens neu erklärt
Astronomie16. Oktober 2025Chemische Überraschung auf Titan: wie Saturns größter Mond die Ursprünge des Lebens neu erklärt Astronomie15. Oktober 2025Gravitationswellen im Nanohertz-Bereich könnten Hinweise auf Schwarze-Loch-Paare geben
Astronomie15. Oktober 2025Gravitationswellen im Nanohertz-Bereich könnten Hinweise auf Schwarze-Loch-Paare geben


Schreibe einen Kommentar