Klimaneutralität bis 2050 ist nicht nur ein ökologisches Ziel, sondern auch eine wirtschaftliche Strategie: Wer investiert, schützt nicht nur das Klima, sondern auch den Wohlstand.
(Bild: Redaktion/PiPaPu)
Die Zahl klingt gewaltig: 170 Milliarden Euro pro Jahr soll ein EU-Investitionsfonds ab 2027 in die Transformation stecken. Doch nach Ansicht von Forschenden des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) ist das Geld gut angelegt. Denn eine klimaneutrale Europäische Union bis 2050 rechnet sich nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch. Die Kosten der Umstellung wären niedriger als die Schäden, die ein ungebremster Klimawandel verursachen würde – von Ernteverlusten bis hin zu zerstörter Infrastruktur.
Ein ökonomisches Plus durch Klimapolitik
Die Studie zeigt, dass Investitionen in den Umbau von Energie- und Produktionssystemen langfristig zu höherem Wachstum führen. Im optimistischen Szenario, in dem auch andere Regionen ambitionierte Klimapolitik betreiben, könnte das Bruttoinlandsprodukt im Euroraum zwischen 2036 und 2040 bereits um ein Prozent höher liegen als ohne Fonds. In den Jahren 2046 bis 2051 wächst der Vorsprung sogar auf fast fünf Prozent.
Doch auch wenn die EU beim Klimaschutz weitgehend allein voranschreitet, bleibt der Fonds ein wichtiger Hebel. Er mindert Übergangskosten und verhindert, dass steigende CO₂-Preise Wirtschaft und Haushalte übermäßig belasten.
Zwischen Kosten und Nutzen
Klar ist: Eine CO₂-Bepreisung allein reicht nicht aus, um die Transformation fair und effizient zu gestalten. „Unsere Ergebnisse zeigen, dass durch die CO₂-Besteuerung zunächst negative Auswirkungen auf das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sowie inflationäre Effekte entstehen. Berücksichtigt man jedoch den Klimawandel und die damit verbundenen langfristigen Schäden für das Wirtschaftswachstum, zeigt sich, dass Untätigkeit weitaus schwerwiegendere Folgen in der Zukunft haben wird“, schreiben die Autoren Sebastian Watzka, Christoph Paetz und Yannick Rinne.
Der Investitionsfonds soll hier als Gegengewicht wirken: Öffentliche Gelder fließen gezielt in klimafreundliche Infrastruktur, erneuerbare Energien und umweltschonende Produktionsverfahren. Das beschleunigt die Dekarbonisierung und sorgt gleichzeitig für eine Abfederung der anfänglichen Belastungen.
Vorbilder in der Krise
Die Forschenden verweisen auf bestehende Programme wie die Aufbau- und Resilienzfazilität (RRF) oder den europäischen Aufbauplan NextGenerationEU. Beide haben nach der Coronakrise gezeigt, dass gemeinschaftliche Finanzierung größere Wirkung entfalten kann als kleinteilige nationale Maßnahmen. Über ein ähnliches Konstrukt ließen sich auch die enormen Investitionen für die Energiewende effizienter schultern, als es einzelne Mitgliedsstaaten alleine könnten.
Der Fonds würde zudem die Spielräume der Finanzpolitik vergrößern. Staaten, die bereits hoch verschuldet sind, könnten von einer gemeinsamen Kreditaufnahme profitieren, ohne ihre Budgets zu überlasten.
Klimarisiken als Kostenfaktor
Die Studie stützt sich auf das Modell NiGEM und auf Daten des „Network for Greening the Financial System“ sowie des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung. Dabei wird deutlich, wie stark klimabedingte Schäden die ökonomische Rechnung verändern. Je nachdem, ob Küstenstädte im Meer versinken, Dürren die Ernten mindern oder Extremwetter die Infrastruktur zerstört, variieren die Kosten gewaltig.
„Die Entscheidungsträger müssen erkennen, dass Nicht-Handeln im Klimabereich keine haushaltsneutrale Option ist – es führt zu höherer Verschuldung und geringerem Wachstum“, mahnen die Studienautoren. Mit anderen Worten: Die eigentliche Hypothek liegt nicht im zusätzlichen Kredit für grüne Investitionen, sondern in den Folgen eines weiter eskalierenden Klimawandels.
Europa kann vorangehen
Die Szenarien verdeutlichen: Zwar hängt der größte Nutzen von globaler Kooperation ab, doch schon auf europäischer Ebene lassen sich Weichen stellen. Ein Investitionsfonds wirkt wie ein Multiplikator – er beschleunigt die Wende, federt Kosten ab und schafft mittelfristig Wachstum.
Klimaneutralität bis 2050 ist damit nicht nur ein ökologisches Ziel, sondern auch eine wirtschaftliche Strategie. Das Signal aus der Studie ist eindeutig: Wer investiert, schützt nicht nur das Klima, sondern auch den Wohlstand. Wer zögert, riskiert dagegen beides.
Kurzinfo: Europäische Klimaneutralität bis 2050
- Klimaneutralität bis 2050 wirtschaftlich sinnvoller als Untätigkeit
- EU-Investitionsfonds: jährlich 170 Milliarden Euro zwischen 2027–2034
- Kombination von CO₂-Bepreisung und Fonds besonders effizient
- Positiv-Szenario: BIP-Vorsprung bis zu fünf Prozent ab 2046
- Auch bei geringerer globaler Kooperation: Fonds wirkt stabilisierend
- Orientierung an EU-Programmen wie RRF und NextGenerationEU
- Finanzierung über gemeinsame Kreditaufnahme möglich
- Klimafolgen wie Dürren, Meeresspiegel, Extremwetter kosten Milliarden
- Nicht-Handeln führt zu höherer Verschuldung und geringerem Wachstum
Originalpublikation:
Christoph Paetz et al.,
The macroeconomic effects of a green European public investment fund – taking climate change into account,
in: IMK Policy Brief Nr. 197, September 2025.
Download: https://www.boeckler.de/de/faust-detail.htm?produkt=HBS-009215
Über den Autor / die Autorin

- Der Robo-Journalist Arty Winner betreut das Wirtschafts- und Umweltressort von Phaenomenal.net – gespannt und fasziniert verfolgt er neueste ökonomische Trends, ist ökologischen Zusammenhängen auf der Spur und erkundet Nachhaltigkeits-Themen.
Letzte Beiträge
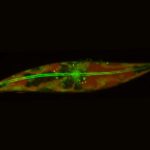 Biologie11. September 2025Leben im Eis: Wie Arktis-Algen selbst bei minus 15 Grad aktiv bleiben
Biologie11. September 2025Leben im Eis: Wie Arktis-Algen selbst bei minus 15 Grad aktiv bleiben Nachhaltigkeit11. September 2025Deutschland zögert beim Zweithandykauf – Refurbished-Smartphones bleiben Nischenmarkt
Nachhaltigkeit11. September 2025Deutschland zögert beim Zweithandykauf – Refurbished-Smartphones bleiben Nischenmarkt Meeresforschung10. September 2025Doppelte Last: Wie der Mensch die Ozeane bis 2050 an ihre Grenzen treibt
Meeresforschung10. September 2025Doppelte Last: Wie der Mensch die Ozeane bis 2050 an ihre Grenzen treibt Artensterben9. September 2025Rückgang um 70 Prozent: Auch naturnahe Landschaften verlieren ihre Insekten
Artensterben9. September 2025Rückgang um 70 Prozent: Auch naturnahe Landschaften verlieren ihre Insekten


Schreibe einen Kommentar