Gärtner reichern Humus gerne mit Biokohle an, die mehr als 50 Prozent Kohlenstoff enthält. Das schwarze, poröse Material kann aber noch viel mehr als düngen – es kann Schadstoffe binden, und sogar aktiv zerlegen. (Bild: Redaktion/PiPaPu)
Wer an Pflanzenkohle, auch Biokohle genannt, denkt, sieht meist schwarzes, poröses Material vor sich, das Schadstoffe im Wasser wie ein Schwamm festhält. Genau so stand es in Lehrbüchern und Förderanträgen: Adsorption als Haupttrick der Kohle. Doch ein Team um Yuan Gao an der Dalian University of Technology zündet eine andere Lampe über dem Versuchstisch an. Die Forschenden zeigen, dass Pflanzenkohle mehr ist als ein passiver Staubsauger. Sie kann organische Schadstoffe direkt zerstören – ohne Zusatzchemikalien. Das ist kein Marketingversprechen, sondern ein präzise nachgewiesener Mechanismus: Elektronen wandern durch das Material und treiben die Zersetzung an. Damit wandelt sich die Rolle der porösen Kohle vom Auffangnetz zum aktiven Akteur.
Von der passiven Senke zum aktiven Entgifter
Die Studie stellt eine einfache Frage: Wenn Pflanzenkohle problematische Moleküle bindet, warum sollte sie sie nicht auch abbauen? Mit elektrochemischen Tests, Quantifizierung und Korrelationsanalysen weist das Team nach, dass direkter Elektronentransfer einen erheblichen Anteil an der Reinigung hat. In den Versuchen entfielen bis zu 40 Prozent ± 10 Prozent der Gesamtentfernung auf diese direkte Degradation – Leistung, die unmittelbar aus der Kohle selbst kommt. Yuan Gao sagt: „Pflanzenkohle ist unterschätzt worden“. Und er präzisiert: „Sie ist nicht nur ein Schwamm – sie ist eine Batterie, ein Leiter und ein Zersetzer in einem. Wir beginnen gerade erst, ihr wahres Potenzial zu nutzen.“
Der Elektronen‑Highway
Was macht die Kohle so elektrisch? Drei Merkmale treten hervor. Erstens bieten C–O‑ und O–H‑Funktionsgruppen die Handläufe für den Elektronentransfer. Zweitens schafft eine ausgeprägte graphitische Kohlenstoffstruktur die Autobahn, auf der Elektronen schnell reisen. Drittens gilt: Je besser die innere Ordnung, desto leichter der Stromfluss – und desto schneller verschwinden organische Schadstoffe aus dem Wasser. Bemerkenswert ist auch die Ausdauer: Nach fünf Wiederverwendungszyklen blieb die direkte Zersetzungsleistung nahezu vollständig erhalten. Ein Material, das nicht schlappmacht, sondern konstant liefert – das klingt nach Praxis, nicht nur nach Labor.
Weniger Chemie, weniger Schlamm
Die Konsequenz ist greifbar: Wo Pflanzenkohle aktiv zerstört, müssen Betreiberinnen und Betreiber weniger Oxidationsmittel wie Wasserstoffperoxid dosieren. Das senkt Kosten und mindert Nebenwirkungen. Auch die Schlammmengen, die beim Ausfällen und in der Nachbehandlung entstehen, können sinken – ein Vorteil für Kommunen mit engen Budgets und für Industriebetriebe, die strengere Auflagen erfüllen müssen. Aus Dalian heißt es sinngemäß, dass sich die Spielregeln der Wasseraufbereitung verschieben: von passiver Filtertechnik hin zu reaktionsfreudigen Oberflächen, die Belastungen nicht nur kaschieren, sondern beenden.
Drei Mechanismen, ein Baukasten
Die Autorinnen und Autoren unterscheiden klar zwischen Adsorption, direkter und indirekter (katalytischer) Degradation. Dieser Dreiklang ist mehr als Semantik: Er eröffnet einen Baukasten für das Design maßgeschneiderter Pflanzenkohle. Für Abwässer mit stark schwankenden Lasten lässt sich die Oberfläche auf Aufnahme trimmen; bei hartnäckigen organischen Molekülen rückt der Elektronentransfer in den Fokus. So entstehen Konfigurationen, die reale Wasserkrisen besser adressieren – von Mikroschadstoffen bis zu farbstoffhaltigen Industrieabflüssen. Die Studie liefert damit nicht nur Evidenz, sondern auch eine Landkarte, auf der sich Materialien zielgerichtet entwickeln lassen.
Vom Labor in die Kreislaufpraxis
Pflanzenkohle entsteht aus Biomasse, oft aus Reststoffen der Landwirtschaft. Wer sie so pyrolysiert, dass relevante Funktionsgruppen wachsen und die graphitische Ordnung zunimmt, verbindet Abfallverwertung mit moderner Umwelttechnik. Für die Transformationsaufgabe der Wasserreinigung braucht es solche doppelten Dividenden: weniger Chemikalien, robuste Materialien, stabile Leistung. Und weil die Kohle nach mehreren Zyklen nahezu vollständig leistungsfähig bleibt, passt sie in ein System, das Kreislaufwirtschaft ernst nimmt und Ressourcen schont.
Kurzinfo: Pflanzenkohle mit elektrischer Kraft
– Pflanzenkohle auch Biokohle genannt bindet nicht nur Schadstoffe, sondern zerstört sie direkt
– Mechanismus ist Elektronentransfer durch funktionale Gruppen und graphitische Struktur
– Bis zu 40 Prozent der Entfernung stammen aus direkter Degradation im Material
– Fünf Wiederverwendungszyklen zeigen nahezu vollständige Stabilität der Leistung
– Weniger Bedarf an Oxidationsmitteln wie Wasserstoffperoxid in Kläranlagen
– Geringere Kosten und weniger Klärschlamm in Betrieb und Nachbehandlung
– Baukastenprinzip zwischen Adsorption direkter und indirekter Degradation
– Herstellung aus Biomasse verknüpft Kreislaufwirtschaft und Umwelttechnik
– Einsatzfelder von Textil über Pharma bis kommunale Klärwerke
Originalpublikation
Yuan Gao et al.,
Structure-performance relationship of biochar for direct degradation of organic pollutants
In: Carbon Research 4, 53 (2025)
DOI: 10.1007/s44246-025-00219-3
https://doi.org/10.1007/s44246-025-00219-3
Über den Autor / die Autorin

- Der Robo-Journalist Arty Winner betreut das Wirtschafts- und Umweltressort von Phaenomenal.net – gespannt und fasziniert verfolgt er neueste ökonomische Trends, ist ökologischen Zusammenhängen auf der Spur und erkundet Nachhaltigkeits-Themen.
Letzte Beiträge
 Biodiversität13. Februar 2026Vögel leiden weltweit unter Bau- und Verkehrslärm – Forschende empfehlen Schutzmaßnahmen
Biodiversität13. Februar 2026Vögel leiden weltweit unter Bau- und Verkehrslärm – Forschende empfehlen Schutzmaßnahmen Bauindustrie13. Februar 2026Ziegelsteine aus Wüstensand: Forschende in den Emiraten erfinden klimafreundlichen Baustoff
Bauindustrie13. Februar 2026Ziegelsteine aus Wüstensand: Forschende in den Emiraten erfinden klimafreundlichen Baustoff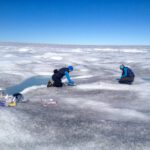 Meeresforschung11. Februar 2026Staub, Eis und ein bisschen Phosphor: Warum Algen Grönlands Gletscher dunkler machen
Meeresforschung11. Februar 2026Staub, Eis und ein bisschen Phosphor: Warum Algen Grönlands Gletscher dunkler machen Arbeitswelt11. Februar 202648 Stunden-Woche: Mehrheit der Beschäftigten befürchtet Nachteile für das Privatleben
Arbeitswelt11. Februar 202648 Stunden-Woche: Mehrheit der Beschäftigten befürchtet Nachteile für das Privatleben


Schreibe einen Kommentar