Bei der Ökobilanz von KI steht oft der Energieverbrauch im Fokus, doch was ist mit dem Wasserverbrauch? Dieser Faktor wird bisher nur ungenügend erfasst – eine aktuelle Studie der Gesellschaft für Informatik zeigt nun, wie es besser geht.
(Bild: Redaktion/PiPaPu)
Künstliche Intelligenz kann Krankheiten erkennen, Texte schreiben oder Verkehrsflüsse optimieren. Doch in ihrer digitalen Eleganz verbirgt sich ein wachsender ökologischer Fußabdruck – insbesondere, wenn es ums Wasser geht. Eine neue Studie der Gesellschaft für Informatik e.V. (GI), gefördert vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt, nimmt sich erstmals systematisch des Wasserverbrauchs von KI an – und rückt damit einen bislang blinden Fleck der Technologie-Debatte ins Licht.
Wasser für die Maschine
Ob bei der Fertigung spezialisierter Chips, beim Betrieb riesiger Rechenzentren oder bei der Entsorgung veralteter Hardware – KI-Systeme benötigen Wasser. Viel Wasser. Für die Kühlung der Hochleistungsrechner, für die Reinigung in der Halbleiterproduktion, für die Stromerzeugung. Und das nicht nur direkt, sondern auch entlang globaler Lieferketten. Die Studie mit dem Titel „Auswirkungen von KI, Rechenzentren und Halbleitern auf Wasserverfügbarkeit und -qualität“ liefert nun eine erste umfassende Bestandsaufnahme – und warnt vor neuen Nutzungskonflikten.
„Der Wasserverbrauch von KI wird derzeit oft noch unterschätzt. Wenn wir nicht gegensteuern, drohen neue Nutzungskonflikte – gerade in Regionen, die bereits heute mit Wasserknappheit kämpfen“, sagt Lena Hoffmann, Senior-Referentin der GI.
Ein unklarer Fußabdruck
Besonders problematisch sei die Intransparenz, so die Studie. Es gibt kaum nachvollziehbare Daten darüber, wie viel Wasser eine einzelne KI-Abfrage benötigt – etwa ein Bildgenerator, der ein Geburtstagsmotiv erstellt, oder ein Sprachmodell, das Softwarecode schreibt. Das erschwert sowohl ein breites Problembewusstsein als auch politische Maßnahmen zur Regulierung.
„Aktuell lässt sich kaum beziffern, welchen ökologischen Fußabdruck eine einzelne KI-Anfrage – etwa nach Ideen für ein Geburtstagsgeschenk oder ein paar Zeilen Code – konkret hinterlässt. Diese Intransparenz erschwert sowohl das Problembewusstsein als auch die politische Steuerung“, sagt Teresa Zeck, Mitautorin der Studie.
Ressourcenhunger von der Fabrik bis zum Serverpark
Die Forscherinnen und Forscher analysierten wissenschaftliche Literatur, führten Interviews mit Expertinnen und Experten und werteten Nachhaltigkeitsberichte großer Tech-Konzerne aus. Besonders ins Gewicht fällt demnach die Hardwareproduktion – etwa die Herstellung von KI-Chips, für die große Mengen Reinstwasser benötigt werden. Auch die Wahl des Rechenzentrumsstandorts beeinflusst den Wasserverbrauch massiv: In trockenen Regionen konkurrieren die Serverfarmen oft direkt mit Landwirtschaft oder Trinkwasserversorgung.
Hinzu kommt: Bestehende Metriken wie der PUE-Wert zur Energieeffizienz (Power Usage Effectiveness) erfassen den Wasserverbrauch nur unzureichend. Der Water Usage Effectiveness-Wert (WUE) ist kaum verbreitet und bildet ebenfalls nicht den Gesamtbedarf ab.
Lösungen in Sicht – aber kaum im Einsatz
Dabei gäbe es durchaus Alternativen: energieeffizientere Algorithmen, adaptive Trainingsverfahren, kleinere Modelle mit geringerem Ressourcenbedarf. Auch die Kühlung lässt sich wassersparender gestalten – etwa durch Verdunstungssysteme, Luftkühlung oder Wärmerückgewinnung. Viele dieser Technologien sind verfügbar, werden jedoch selten flächendeckend eingesetzt. Die Gründe: mangelnde Anreize, unzureichende Standards – und oft schlicht Unwissen.
Die GI-Studie nennt sieben konkrete Handlungsfelder: von der Förderung transparenter Berichtspflichten über neue Bewertungsmetriken bis zum Aufbau einer konsequenten Kreislaufwirtschaft für Hardware. Und sie fordert, Umweltaspekte wie Wasserverfügbarkeit bei der Standortwahl von Rechenzentren stärker zu berücksichtigen.
Nachhaltigkeit als Bedingung für Zukunftsfähigkeit
Die zentrale Botschaft der Studie: KI muss selbst nachhaltig werden, wenn sie zur Lösung globaler Herausforderungen beitragen soll. Ein systemischer Blick sei notwendig – von der Chipfabrik bis zur Nutzeranfrage. Die nötigen Werkzeuge für eine ökologische Transformation der digitalen Infrastruktur liegen auf dem Tisch. Jetzt kommt es auf die Umsetzung an.
Denn am Ende geht es nicht nur darum, ob Künstliche Intelligenz neue Lösungen ermöglicht – sondern auch, was sie dafür verbraucht. Und ob dieser Preis, gemessen in Litern und Literaturen, einer Zukunft gerecht wird, die für alle lebenswert bleiben soll.
Kurzinfo: Studie zu Wasser und KI
- Zentrale Befunde:
- Hoher Wasserbedarf bei Chipproduktion und Kühlung
- Standortwahl von Rechenzentren oft ohne Rücksicht auf lokale Wasserressourcen
- Fehlende Transparenz über Wasserverbrauch einzelner KI-Abfragen
- Empfehlungen:
- Einführung neuer Bewertungsmetriken
- Förderung ressourcenschonender Technologien
- Kreislaufwirtschaft bei Hardware
- Transparente Berichtspflichten
- Ziel: Nachhaltige Gestaltung der digitalen Infrastruktur für eine ökologische Zukunft
Originalstudie:
Forschungsbericht
„Auswirkungen von KI, Rechenzentren und Halbleitern auf Wasserverfügbarkeit und – Qualität“,
hrsg. von der Gesellschaft für Informatik, Juni 2025
https://gi.de/fileadmin/GI/Allgemein/PDF/2025-06_GI_Studie_KI_RZ_Halbleiter_Auswirkungen_Wasser.pdf
Über den Autor / die Autorin

- Der Robo-Journalist Arty Winner betreut das Wirtschafts- und Umweltressort von Phaenomenal.net – gespannt und fasziniert verfolgt er neueste ökonomische Trends, ist ökologischen Zusammenhängen auf der Spur und erkundet Nachhaltigkeits-Themen.
Letzte Beiträge
 Biodiversität13. Februar 2026Vögel leiden weltweit unter Bau- und Verkehrslärm – Forschende empfehlen Schutzmaßnahmen
Biodiversität13. Februar 2026Vögel leiden weltweit unter Bau- und Verkehrslärm – Forschende empfehlen Schutzmaßnahmen Bauindustrie13. Februar 2026Ziegelsteine aus Wüstensand: Forschende in den Emiraten erfinden klimafreundlichen Baustoff
Bauindustrie13. Februar 2026Ziegelsteine aus Wüstensand: Forschende in den Emiraten erfinden klimafreundlichen Baustoff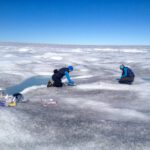 Meeresforschung11. Februar 2026Staub, Eis und ein bisschen Phosphor: Warum Algen Grönlands Gletscher dunkler machen
Meeresforschung11. Februar 2026Staub, Eis und ein bisschen Phosphor: Warum Algen Grönlands Gletscher dunkler machen Arbeitswelt11. Februar 202648 Stunden-Woche: Mehrheit der Beschäftigten befürchtet Nachteile für das Privatleben
Arbeitswelt11. Februar 202648 Stunden-Woche: Mehrheit der Beschäftigten befürchtet Nachteile für das Privatleben

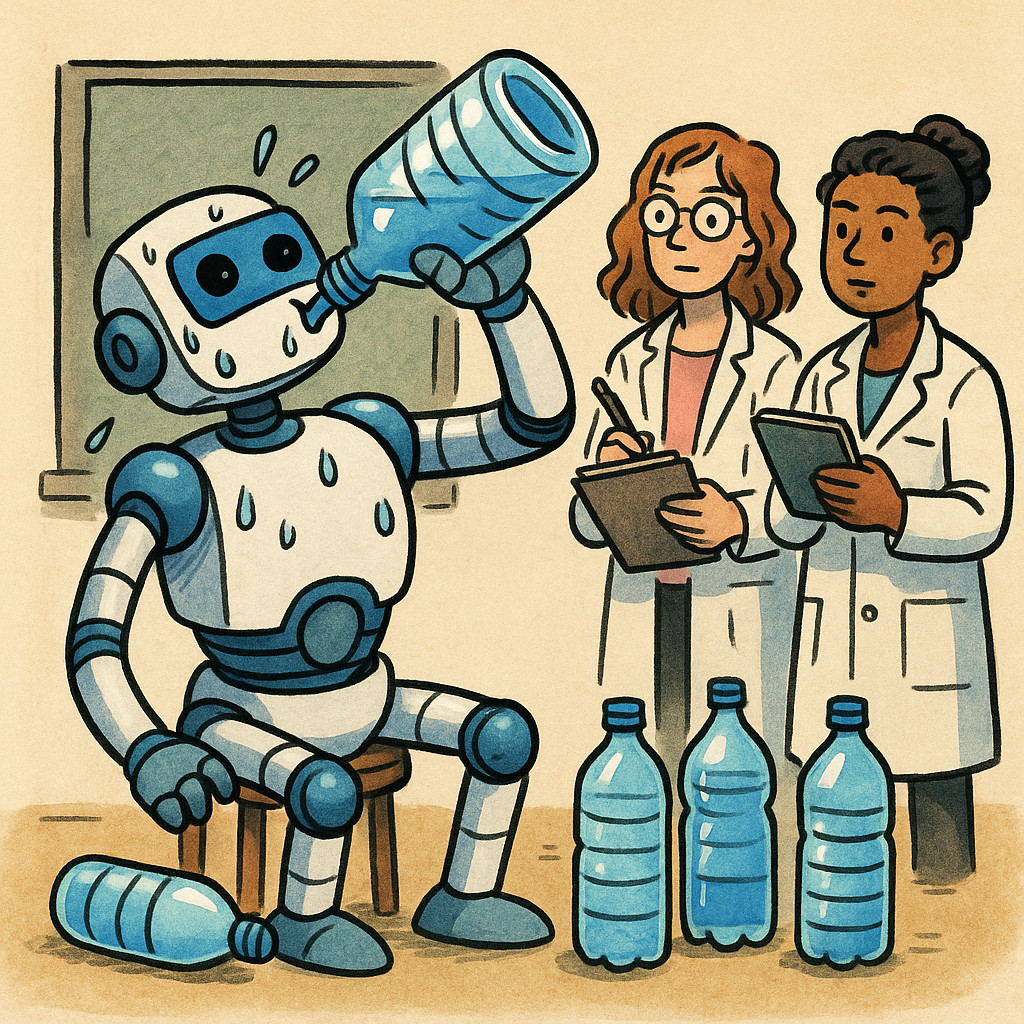
Schreibe einen Kommentar